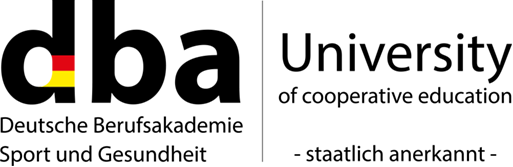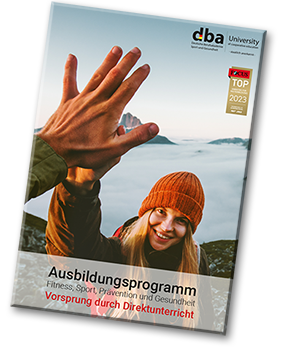Trainer für Kraft und Muskulatur
Gesundheits- und leistungsorientiertes Krafttraining

Der Lehrgang vermittelt die Grundlagen eines sowohl gesundheits- als auch leistungsorientierten Krafttrainings. Differenzierte Übungsanalysen unter Berücksichtigung anatomisch-physiologischer, funktioneller und biomechanischer Aspekte geben einen Überblick in allen Facetten des Krafttrainings und ermöglichen eine sinnvolle und zielgerichtete Übungsauswahl unter den verschiedensten Trainingsbedingungen. Ein weiterer Schwerpunkt ist der methodische Aufbau eines Krafttrainingsprogramms unter Berücksichtigung der vielfältigen individuellen Voraussetzungen und Trainingszielstellungen vom Anfänger bis zum Hochleistungssportler, in Prävention und Rehabilitation. Sie lernen vielfältige Übungsvariationen mit der Kurz- und Langhantel kennen. Dazu gibt es gezielte Informationen, wie unterschiedliche Trainingspläne für spezielle Zielgruppen erstellt werden.
%
Qualifikationslevel
Die Lehrinhalte
Krafttrainingsgrundlagen
- Ziele des Krafttrainings
- Übungsanalysen unter anatomisch und funktionellen Gesichtspunkten
Spezifisches Krafttraining, anwendungsorientiert
- Theorien des Muskelwachstums und ihre praktische Umsetzung im Trainingsalltag
- Trainingsmethoden im Krafttraining und ihre Anwendung im Gesundheits-, Fitness- und Leistungssport
- Training der Maximalkraft für langfristige Trainingsfortschritte
- Überlastungsstrategien im leistungsorientierten Kraftsport
Trainingsplanung in der Praxis
- Trainingssteuerung und Periodisierung
- Steuerung und Planung eines individuellen Trainingsaufbaus
Grundlagen des Schnell- und Sprungkrafttrainings
- Sprints, Sprünge und ihr Einsatz im sportlichen Training
- Sportartspezifische Übungsprogramme
Langhantel/Kettlebelltraining in der Praxis
- Erlernen der Techniken von Gewichtheberübungen
- Vermittlung der richtigen Kettlebelltechnik
- Erstellen von Trainingsprogrammen
Ablauf der Ausbildung
Für beide Lehrgangswochenenden sind folgende Lehrgangszeiten vorgesehen:
Freitag: 14:00 – 19:30 Uhr
Samstag: 08:30 – 17:30 Uhr
Sonntag: 08:30 – 14:30 Uhr
Die genauen Lehrgangszeiten werden Ihnen ca. 14 Tage vor Lehrgangsbeginn zugesendet. Mögliche Änderungen behalten wir uns vor und werden Ihnen rechtzeitig schriftlich mitgeteilt.
Beide Lehrgangswochenenden umfassen ausgewogene Anteile theoretischen und praktischen Unterrichts. Bitte denken Sie daran, an beiden Wochenenden ausreichend Sportkleidung (inkl. Handtuch) mitzubringen. Die Teilnahme an allen Praxiseinheiten ist obligatorisch. Ausnahmen sind nur mit einem ärztlichen Attest möglich.
Das Lehrgangsmaterial (ca. 140 Seiten Lehrbrief) wird Ihnen 3 Wochen vor Lehrgangsbeginn im Downloadbereich zur Verfügung gestellt. Auf Wunsch kann Ihnen das Lehrgangsmaterial auch kostenpflichtig (ab 15,00 € zzgl. Versand) zugeschickt werden, bzw. dieses auch an den jeweiligen Standorten erworben werden.
Zusätzlich zu diesen 3 Wochen Vorbereitungszeit, haben Sie zwischen den beiden Lehrgangswochenenden 4 Wochen Zeit, die theoretischen Inhalte des ersten Wochenendes und des Lehrbriefes aufzuarbeiten und die sportpraktischen Inhalte der Praxiseinheiten zu üben und zu verinnerlichen.
Welche Voraussetzungen werden benötigt?
Quereinstiege durch Absolventen anderer Vorbildungen sind nach Anerkennung durch den Lehrausschuss der dba möglich.
Die Prüfung
- Das Fachseminar „Trainer für Kraft & Muskulatur“ kann mit einer Klausur (60 min Bearbeitungszeit) auf Basis der Lehrmaterialien abgeschlossen werden. Nach bestandener Klausur erhält der Absolvent ein Zertifikat sowie eine Urkunde.
- Ohne Prüfung erhält der Absolvent eine Teilnahmebestätigung.
Nutze bei jeder Aus- und Weiterbildung die Vorteile der dflv
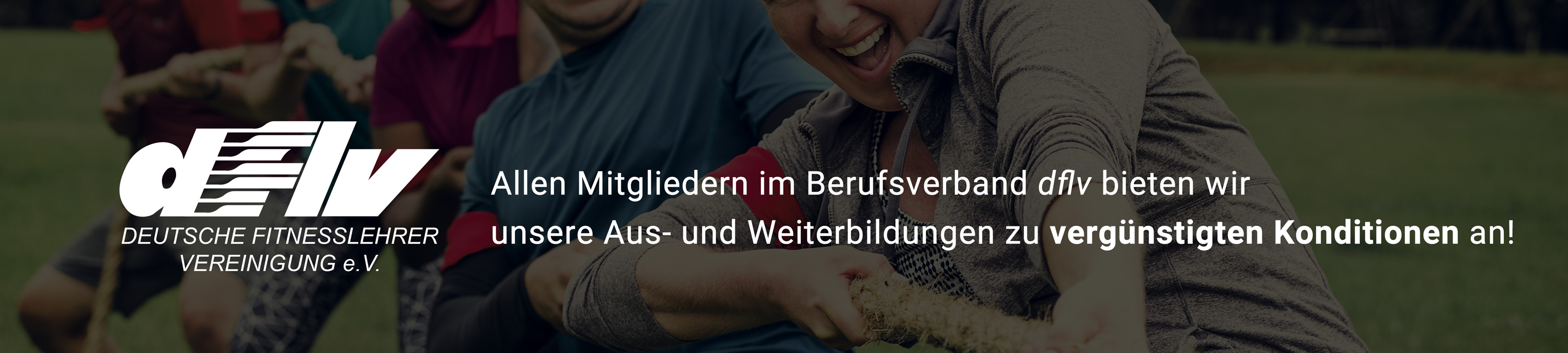
Mehr Informationen zum Berufsverband und allen Vorteilen hier
Wir empfehlen dir folgende Aus- und Weiterbildungen als nächstes

Athletiktrainer:in
Athletiktrainer-Spezialisten werden mittlerweile auf allen Ebenen des Wettkampfsports gesucht. Ob Fußball...WEITERLESEN

Fachsportlehrer:in Fitness und Gesundheit
Berufsabschluss mit ZPP-Zertifizierung nach §20 SGB V...WEITERLESEN

Trainer für Langhantel und Gewichtheben
Erlernen Sie die hohe Funktionalität des LanghanteltrainingsWEITERLESEN